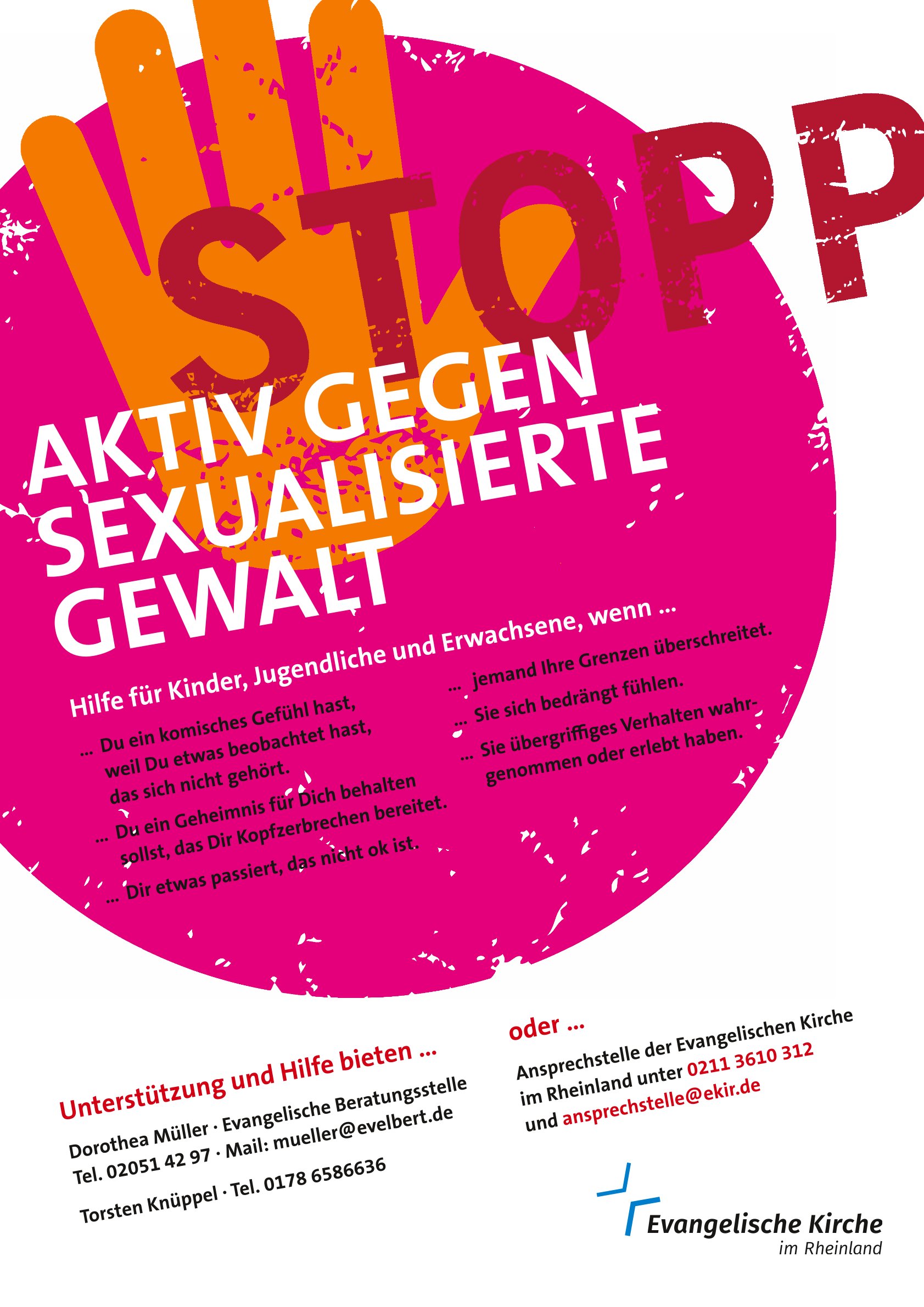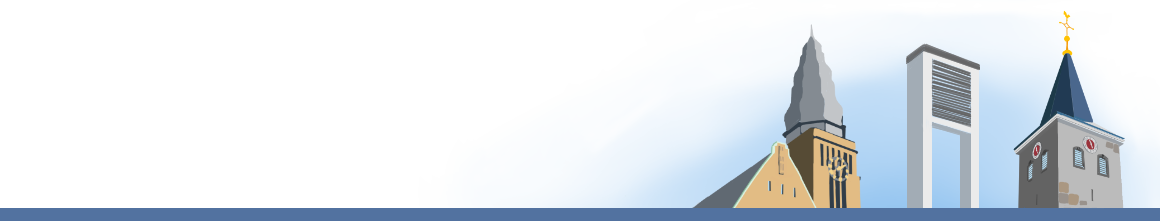

Evangelisch in Velbert

Ist das Gott oder kann das weg?
Ich frage mich gerade, wie lang die Halbwertzeit von Ostern ist. Jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, ist es noch zwei Wochen hin bis Ostern. Wenn Sie das in den Händen halten und lesen, liegt Ostern schon circa eine Woche zurück. Was bleibt außer ein paar bunten Eierschalen und der Deko, die fürs nächste Jahr wieder in den Schrank wandert? Ein Gefühl von Frühling? Hoffnung? Aufbruch? Von seinem Ursprung her ist Ostern ein ziemlich schräges Fest. Im Zentrum steht bzw. liegt ein gekreuzigter Jesus, tot in seinem Grab. Seine Jünger sind frustriert und voller Angst. Drei Jahre sind sie ihm gefolgt, haben gehofft und geglaubt, dass ihr Rabbi von Gott kommt und eine neue Art von Wirklichkeit in die Welt

Ist das Gott oder kann das weg?
Ich frage mich gerade, wie lang die Halbwertzeit von Ostern ist. Jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, ist es noch zwei Wochen hin bis Ostern. Wenn Sie das in den Händen halten und lesen, liegt Ostern schon circa eine Woche zurück. Was bleibt außer ein paar bunten Eierschalen und der Deko, die fürs nächste Jahr wieder in den Schrank wandert? Ein Gefühl von Frühling? Hoffnung? Aufbruch? Von seinem Ursprung her ist Ostern ein ziemlich schräges Fest. Im Zentrum steht bzw. liegt ein gekreuzigter Jesus, tot in seinem Grab. Seine Jünger sind frustriert und voller Angst. Drei Jahre sind sie ihm gefolgt, haben gehofft und geglaubt, dass ihr Rabbi von Gott kommt und eine neue Art von Wirklichkeit in die Welt
Gottesdienstzeiten sind sonntags
– in der Markuskirche: 10.30 Uhr
– in der Christuskirche: 11.00 Uhr
Bitte prüfen Sie anhand dieser Suchliste, ob überhaupt ein Sonntagsgottesdienst stattfindet.
Die folgenden Termine sind klickbar!
Rudi’s Kinderkirche
20 April – 10:00 – 11:00Oasegottesdienst
21 April – 10:30Friedensgebet
26 April – 19:00Konfirmandengottesdienst
27 April – 18:00Konfirmation
28 April – 10:00
Downloads & Links
Hier finden Sie den aktuellen Gemeindebrief.
Hier finden Sie den aktuellen Newsletter.
Hier gelangen Sie zu unserem YouTube-Kanal.
Gespeicherte Gottesdienste stehen nur für drei Tage zur Verfügung!